LeTe-Protein: Gewinnung von nachhaltigen Proteinquellen (Wasserlinse und Mehlkäferlarve) mit Nebenrohstoffen und deren Einsatz in der Aquakultur
Zusammenfassung
Das Projekt LeTe-Protein widmete sich der Erforschung nachhaltiger und regionaler Proteinquellen für die Fischfütterung. Im Mittelpunkt standen die Kultivierung der Wasserlinse (Lemna minor) und die Zucht von Mehlkäferlarven (Tenebrio molitor), wobei Nebenprodukte aus der Landwirtschaft und Aquakultur als Substrate genutzt wurden. Ziel war es, ein kreislauforientiertes Futtermittelkonzept zu entwickeln, das sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll ist. Die Ergebnisse zeigen ein hohes Potenzial für die regionale Fischfütterung, insbesondere in Österreich, wo der Selbstversorgungsgrad bei Speisefisch lediglich bei rund sechs Prozent liegt. Gleichzeitig wurden Herausforderungen wie die Belastung der Wasserlinsen mit Schwermetallen deutlich, die weiterer Forschung bedürfen.
Projektbeschreibung
Ressourcenmanagement und Kreislaufwirtschaft bildeten die übergeordneten Themenfelder des Projekts LeTe-Protein. Ziel war es, neues Wissen zur weitgehenden Schließung von Stoffkreisläufen zu generieren – insbesondere im Bereich der regionalen Fischmast, bei der Mischfutter aus regionalen Komponenten eingesetzt wurde. Dabei sollten Reststoffquellen nicht nur verwertet, sondern gezielt veredelt werden. Im Zentrum der Forschung stand das Potenzial zur Kultivierung der Wasserlinse (Lemna minor) unter Verwendung von Restwasser aus einer geschlossenen Aquakultur-Kreislaufanlage. Parallel dazu wurden Aufzuchtversuche mit Mehlkäferlarven (Tenebrio molitor) durchgeführt, wobei Nebenprodukte aus der Kräuter- und Körnerverarbeitung als Substrat dienten.
Die regional gewonnenen Wasserlinsen und Mehlkäferlarven wurden zu hochwertigen Proteinquellen verarbeitet und in Fütterungsversuchen hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit in der Fischernährung getestet. Die Erzeuger tierischer Produkte stehen zunehmend unter Druck, da Konsumentinnen und Konsumenten verstärkt Fragen zur Herkunft und Produktionsweise von Lebensmitteln sowie zu den verwendeten Futtermitteln stellen. Ein zentraler Bestandteil konventionellen Fischfutters ist Fischmehl, dessen weltweite Produktion zu etwa 75 Prozent in der Fischfütterung verwendet wird. Vor diesem Hintergrund wurde im Projekt die Möglichkeit einer nachhaltigen und regionalen Alternative zu Fischmehl untersucht.
Die Erzeugung von Futtermitteln aus Produkten geschlossener Kreislaufsysteme stellt ein bislang kaum erforschtes Zukunftspotenzial dar. Die Produktion von Wasserlinsen und Mehlkäferlarven innerhalb eines solchen Kreislaufs bietet vielversprechende Ansätze zur Bereitstellung hochwertiger Proteine für die tierische Ernährung aus regionalen Rohstoffen. Diese Kulturen ermöglichen es, Abwasser aus Fisch-Kreislaufanlagen sowie pflanzliche Nebenprodukte aus der landwirtschaftlichen Primärproduktion als wertvolle Ressourcen wieder in den Kreislauf der tierischen Ernährung zurückzuführen.
Angesichts eines Selbstversorgungsgrads von lediglich rund sechs Prozent bei Speisefisch in Österreich ergibt sich ein erheblicher Bedarf an der Steigerung der heimischen Fischproduktion und der Entwicklung geeigneter Futtermittel. Regional erzeugte Proteinquellen wie getrocknete Wasserlinsen in Kombination mit Mehlkäferlarvenmehl bieten eine vielversprechende Grundlage für ein bedarfsgerechtes und effizientes Fischfutter in der österreichischen Fischhaltung. Im Projekt wurde der Wels (Clarias gariepinus) als Modellfisch für die Fütterungsversuche ausgewählt.
Ergebnisse
Im Rahmen des Projekts wurden zwei Hauptansätze zur Verwertung von Reststoffen verfolgt. Zum einen wurde das nährstoffreiche Restwasser aus der Fischzucht zur Kultivierung der Wasserlinse genutzt. Die Produktion erfolgte in zwei Phasen: zunächst in einer Versuchsanlage mit etwa acht Quadratmetern Fläche, später in einer auf hundert Quadratmeter erweiterten Anlage. Die Wasserlinsen zeigten sehr hohe Proteingehalte zwischen 33 und 42,5 Prozent in der Trockenmasse. Die Erntemengen stiegen bis zum Projektende kontinuierlich an. Allerdings wurde festgestellt, dass Wasserlinsen zur Akkumulation von Elementen neigen. Neben hohen Gehalten an Schwefel, Zink und Mangan wurden auch bedenklich hohe Konzentrationen von Arsen, Blei und Cadmium gemessen, die teilweise über den zulässigen Grenzwerten der Richtlinie 2002/32/EG lagen.
Zum anderen wurde die Zucht von Mehlkäferlarven optimiert. Die Population konnte deutlich vergrößert und die Haltungsbedingungen verbessert werden. Verschiedene Nebenprodukte aus der Kräuter- und Körnerverarbeitung wurden als Substrate getestet. Besonders Roggengrünmehlpellets erwiesen sich als geeignetes Substrat für die Käfer. Bei Larven, die mit Öllein-Nebenprodukten gefüttert wurden, konnte der Anteil an Omega-3-Fettsäuren signifikant erhöht werden – von ursprünglich 1–2 Gramm auf bis zu 15–32 Gramm pro 100 Gramm Fett.
In einem Fütterungsversuch mit Bachsaiblingen (Salvelinus fontinalis) wurde die Akzeptanz des neu entwickelten Futters getestet. Die Versuchsfische nahmen das Futter gut an, zeigten jedoch eine auffällige gelb-grünliche Färbung, insbesondere am Bauch und an den Flossen. Diese Veränderung ist vermutlich auf die hohen Carotinoidgehalte der Wasserlinse zurückzuführen.
Nutzen des Projekts
Das Projekt LeTe-Protein hat den Grundstein für eine kreislauforientierte und nachhaltige Fischfutterproduktion gelegt. Es zeigt, wie hochwertige Proteine aus regionalen Rohstoffen gewonnen und verwertet werden können. Die Ergebnisse leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Österreichischen Eiweißstrategie und fördern eine ressourceneffiziente Versorgungskette für Lebensmittel. Die Verwertung von Nebenprodukten steht dabei im Mittelpunkt: In der Waldland-Aquakultur-Kreislaufanlage fallen jährlich rund 5.000 Kubikmeter Fischrestwasser an, während bei der Kräuter- und Körnerverarbeitung etwa 4.000 Kubikmeter Kräuterreste und 370 Tonnen Körnerabfall entstehen. Diese bislang ungenutzten Rohstoffe können durch die im Projekt entwickelten Verfahren sinnvoll in die tierische Ernährung zurückgeführt werden. Das Konzept bietet nicht nur ökologische Vorteile, sondern stärkt auch die regionale Wertschöpfung und trägt zur Unabhängigkeit von globalen Futtermittelmärkten bei.
Projektdetails
Projekttitel: LeTe-Protein - Gewinnung von nachhaltigen Proteinquellen (Wasserlinse und Mehlkäferlarve) mit Nebenrohstoffen und deren Einsatz in der Aquakultur
Projektakronym: LeTe-Protein
Projektleitung: Elisabeth Reiter, AGES
Projektpartner: Waldland GmbH
Finanzierung: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft - DAFNE
Projektlaufzeit: 20.10.2022 - 20.05.2025
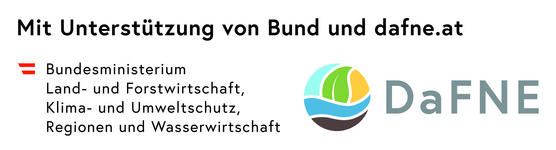
Dieses Projekt wurde im Rahmen des Ressortforschungsprogramms über dafne.at mit Mitteln des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft finanziert. Das BMLUK unterstützt angewandte, problemorientierte und praxisnahe Forschung im Kompetenzbereich des Ressorts.
Weitere Informationen
Aktualisiert: 25.08.2025